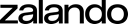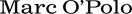Nachhaltigkeit
Gemeinschaft
Fußball ist für alle da.
Damit stellt er eine ideale Begegnungsstätte dar - für Menschen jeden Alters, sozialer Schicht, ethnischer Herkunft, Religionen, aller sexueller Identitäten und Geschlechter, ganz gleich ob mit und ohne Behinderung.
Der Deutsche Fußball-Bund tritt dafür ein, dass
Fußball ein sicherer Ort für alle ist, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
alle Menschen ohne Angst vor Diskriminierung am Fußball teilhaben können, auf und neben dem Platz.
Fußball die Vielfalt der Gesellschaft, in der er stattfindet, abbildet.
überall im Fußball ein Klima des Respekts und der Mitmenschlichkeit selbstverständlich ist.
die identitätsstiftende Wirkung des Fußballs für die ganze Gesellschaft genutzt und erhalten wird.
Kontakt:
Kinder- und Jugendschutz
Kinder- und Jugendschutz
Weitere Projekte gegen Diskriminierung
Gegen Rassismus
Queer im Fußball
JULIUS HIRSCH PREIS
Unterstützung für Menschen mit Fluchterfahrung
Für viele Menschen mit Fluchterfahrung kann Fußball eine wichtige Stütze und erster Anker zur Integration in die Gesellschaft sein. Fußball ist ein globales Spiel, der organisierte Sport dagegen nicht überall bekannt. Um den Ball dennoch ins Rollen zu bringen, engagieren sich viele Vereine mit Einstiegsangeboten für geflüchtete Menschen oder suchen lokale Kooperationen. Unsere Broschüre unterstützt dabei und informiert darüber, was Fußballer*innen und Vereine beachten müssen:
Geflüchteten im Fußball
Fußball ist ein globales Spiel, der organisierte Sport dagegen nicht überall bekannt. Um den Ball dennoch ins Rollen zu bringen, engagieren sich viele Vereine mit Einstiegsangeboten für Geflüchtete oder suchen lokale Kooperationen.
Wer macht den ersten Schritt?
Geflüchtete müssen sich in einer neuen Umgebung orientieren und haben oft nur wenige soziale Kontakte. Für die Freizeitgestaltung fehlen Mittel und Wege. Viele Unterkünfte liegen in städtischen Randgebieten und selten im direkten Umfeld eines Sportvereins. In unsicheren Lebenssituationen treten Menschen ungern als Bittsteller auf. Vereine können daher aktiv auf Geflüchtete zugehen und sich über ihre konkrete Situation informieren. Ein Verhältnis „auf Augenhöhe“ ist dabei wichtig. Viele Geflüchtete haben ein großes Interesse, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen – auch ohne Vorerfahrungen im Vereinssport. Interkulturelle Kompetenzen helfen weiter: Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit eigener Fluchterfahrung (z. B. in Coach-Tandems) stiften Vertrauen und fungieren als kulturelle und sprachliche Mittler. Ebenso wichtig ist es, unter den eigenen Vereinsmitgliedern für Unterstützung und Offenheit zu werben.
Wie können Vereine Geflüchtete für Ihre Angebote gewinnen?
Vereinsangebote können mit Unterstützung lokaler Geflüchteteninitiativen, von Fördervereinen oder der Sozialarbeit direkt in den Unterkünften beworben werden. Mehrsprachige Informationen und persönliche Gespräche sind wichtig. Verantwortlich für Geflüchtetenbelange sind die Kommune, insbesondere Ausländerbehörde und Sozialamt, aber z. B. auch die Integrationsbeauftragten. Auch die Vernetzung in lokalen Willkommensbündnissen und die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Institutionen ermöglichen neue Zugänge. Um Geflüchtete für reguläre Vereinsangebote zu gewinnen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Hemmschwellen abzubauen und gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Mit Angeboten und Veranstaltungen in Unterkünften (z. B. einem Fair-Play-Turnier) lassen sich Begegnungen schaffen. Schnuppertrainings oder regelmäßig stattfindende offene Angebote sind für Geflüchtete attraktiv, die nicht immer wissen, ob und wie lange sie am Ort bleiben können. Auch Schulen, in denen geflüchtete Kinder und Jugendliche oftmals zusätzlich in Willkommensklassen betreut werden, können ein Kooperationspartner sein.
Wie können geflüchtete Mädchen und Frauen für Vereinsangebote erreicht werden?
In vielen Ländern ist Fußball unter Mädchen und Frauen weit weniger verbreitet als in Deutschland. Der Sport ist aufgrund seines Körperbezugs mitunter ein besonders sensibles Feld. Gesucht werden daher überzeugende Brückenbauer: Trainerinnen, die als sportliche Vorbilder und kulturelle Botschafterinnen Mädchen, Frauen und Eltern – insbesondere auch Väter und Partner – gewinnen können. Die direkte Ansprache, persönliche Überzeugungsarbeit und Verlässlichkeit sind wichtige Faktoren. Auch der Rahmen sollte stimmen: geschlechtsgetrennte Trainingsgruppen, separate Umkleide- und Waschräume und Trainingszeiten vor der Dämmerung. Um etwas Neues auszuprobieren, kann ein geschützter Raum, wie eine Sporthalle, geeigneter sein als der Sportplatz. Erfolgreiche Angebote verknüpfen zudem sportliche und soziale Aspekte. Nicht immer sind Vorbehalte religiös oder kulturell motiviert: Betreuungs- oder Parallelangebote für Mütter und ihre Kinder können die gemeinsame Freizeit im Verein ermöglichen. Ein Einstieg können auch geschlechtshomogene Fußball-AGs in Schulen sein. In zahlreichen DFB-Landesverbänden bestehen bereits erfolgreiche Fußballprojekte für Mädchen.
Sportvereine spielen für das alltägliche Leben in Deutschland eine herausragende Rolle. Durch eine Mitgliedschaft eröffnen sich nicht nur sportliche Perspektiven, sondern auch soziale Kontakte. Dem DFB, seinen Verbänden und Vereinen ist es daher ein Anliegen, Geflüchteten so unkompliziert wie möglich die Teilnahme an Training und Spielbetrieb zu ermöglichen.
Welche Besonderheiten gibt es bei der Aufnahme von Geflüchteten in den Verein?
In den meisten Fragen des Vereinsfußballs macht es zunächst keinerlei Unterschied, ob ein Mitglied Ausländer oder Geflüchteter ist. Mit den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln und der Aufenthaltsdauer von Geflüchteten in Deutschland hängen zwar Rechte und Pflichten und verfügbare Integrations- und Unterstützungsmöglichkeiten zusammen, für das gemeinsame Spiel im Verein sind sie jedoch zunächst unbedeutend. Auch mögliche Hürden, wie Spielberechtigungen, Versicherungsschutz und die Mitwirkung im Verein, lassen sich überwinden (siehe folgende Kapitel). Viel wichtiger als Formalitäten sind die aktiven Hilfestellungen durch Trainerinnen und Trainer oder Mitspielerinnen und Mitspieler, um geflohenen Menschen den Einstieg in den Verein zu erleichtern. Sprachliche Barrieren und Vorbehalte können so durchbrochen werden. Viele Vereine bieten bedürftigen Menschen auch ermäßigte Tarife oder eine zeitweilige Befreiung von Beiträgen und Aufnahmegebühren oder helfen bei der Bürokratie.
Wer ist für Minderjährige ohne Eltern verantwortlich?
Viele minderjährige Geflüchtete kommen ohne Angehörige nach Deutschland. Minderjährige Asylbewerberinnen oder Asylbewerber, Asylberechtigte oder anderweitig anerkannte Geflüchtete, deren Eltern sich nicht im Bundesgebiet aufhalten, erhalten deshalb durch das Familiengericht einen Vormund, der die Funktion der Eltern wahrnimmt. Vormund kann eine Privatperson, aber auch ein Behördenvertreter (z. B. ein Mitarbeiter des Jugendamtes) sein. In der Praxis werden mitunter bestimmte Befugnisse schriftlich durch den Vormund an Dritte übertragen (z. B. einen Sozialarbeiter oder die Unterkunftsleiterin), die fortan die „Belange des täglichen Lebens“ regeln dürfen. Eine solche schriftliche Übertragung reicht aus, um beispielsweise die Mitgliedschaft Minderjähriger in einem Verein oder eine Spielberechtigung beim Verband zu beantragen. Hilfreich ist es, wenn direkt auf dem Aufnahmeformular des Vereins eine Kontaktperson benannt ist, die für allgemeine Fragen oder im Notfall zu erreichen ist.
Kann ich den Altersangaben in den Papieren vertrauen?
Viele Geflüchtete kommen ohne jegliche Papiere nach Deutschland. Insbesondere Altersangaben geben immer wieder Anlass zu strittigen Auseinandersetzungen. Für Vereine und Verbände besteht jedoch kein Grund, behördliche Dokumente (z. B. Aufenthaltstitel) in Zweifel zu ziehen oder die dortigen Angaben selbst zu überprüfen. Dies gilt auch, wenn in den Dokumenten vermerkt sein sollte, dass die dort festgehaltenen Daten auf eigene Angaben des Inhabers zurückgehen.
Verletzungen sind im Fußball trotz aller Vorsicht unvermeidbar – natürlich auch wenn Geflüchtete mitspielen. Für Vereine, Mitglieder und Aktive besteht jedoch wenig Anlass zur Sorge.
Sind Geflüchtete krankenversichert?
Menschen mit befristeten und unbefristeten Aufenthaltstiteln, einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung sind grundsätzlich krankenversichert oder haben Anspruch auf Gesundheitsversorgung, auch wenn sie nicht arbeiten oder nur wenig verdienen. In Notfallsituationen, wenn z. B. nach einem Trainingsunfall der Rettungswagen gerufen werden muss, ist die Kostenübernahme in jedem Fall gewährleistet. Ärzte und Krankenhäuser sind zur Hilfe verpflichtet. Für Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, existieren jedoch in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts Leistungseinschränkungen, insbesondere für Rehabilitationsmaßnahmen, wie z. B. Physiotherapie. Auch wird die Gesundheitsversorgung nicht durch eine reguläre Krankenkasse, sondern über das Sozialamt abgewickelt, das Krankenscheine für den Arztbesuch ausstellt.
Wer kommt im Falle eines Unfalls für Schäden auf?
Die Kosten übernimmt grundsätzlich zunächst die (gesetzliche oder private) Krankenversicherung oder die Gesundheitsversorgung der betroffenen Person. Darüber hinaus sind alle Vereine, die einem Landessportbund bzw. -verband (LSB/LSV) angehören, und deren Mitglieder (also auch Geflüchtete, die Mitglieder eines Sportvereins sind) im Rahmen einer Gruppenversicherung (der sog. „Sportversicherung“) mindestens unfall-, haftpflicht- und in den meisten Fällen auch rechtsschutzversichert. Der Versicherungsschutz gilt für Mitglieder ebenso wie für im Verein Tätige und gilt bei allen satzungsgemäßen Vereinsveranstaltungen einschließlich des direkten Hin- und Rückwegs – ob Training, Wettkampf, Mitgliederversammlung oder Feier. Die Sportversicherung versteht sich als eine Beihilfe; ein Schwerpunkt ist die Leistung bei verbleibenden Dauerschäden (Invalidität). Die Versicherungssummen der Sportversicherungen unterscheiden sich innerhalb der LSB/LSV. Wichtig ist die zügige Meldung eines Schadenfalles – egal welcher Art – an den Verein bzw. die regelmäßig bei den LSB/LSV angesiedelten Versicherungsbüros. Übungsleiterinnen und Übungsleiter tragen dabei eine Mitverantwortung.
Existiert eine Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten?
Auch hier gilt: Für Geflüchtete, die Vereinsmitglieder sind, gelten die gleichen Bestimmungen wie für alle anderen auch. Die Haftpflichtversicherung innerhalb der Sportversicherung der LSB/LSV schützt bei fahrlässig verursachten Schäden und daraus folgenden Schadenersatzansprüchen Dritter, z. B. bei Personenschäden oder versehentlichen Sachbeschädigungen (z. B. des Waschbeckens in der Umkleide).
Sind nur Vereinsmitglieder versichert?
Viele LSB/LSV haben zusätzliche Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Geflüchtete abgeschlossen, die bei der Teilnahme an Sportangeboten und Aktivitäten von Sportvereinen auch unabhängig von der Vereinsmitgliedschaft Schutz gewährleisten. Demnach besteht ein Versicherungsschutz beispielsweise auch bei offenen Angeboten eines Vereins, für die keine Mitgliedschaft erforderlich ist.
In welchem Umfang der Versicherungsschutz für Vereinsmitglieder wie auch für Nicht-Mitglieder gewährleistet ist, sollte beim jeweiligen Verein, Verband oder den Versicherungsbüros der LSB/LSV erfragt werden!Selbstverständlich können Geflüchtete ihr Team auch am Spieltag verstärken. Eine Beschränkung der Anzahl eingesetzter ausländischer Spielerinnen und Spieler existiert im Amateurfußball nicht. Die Neuregelung der Residenzpflicht erleichtert Geflüchteten die Fahrten zu Auswärtsspielen. Für die Beantragung einer Spielberechtigung existieren bei internationalen Vereinswechseln jedoch besondere Auflagen.
Wie können Geflüchtete einen Spielerpass bekommen?
Eine Spielberechtigung muss wie gewöhnlich durch den betreffenden Verein bei der Passstelle des jeweiligen Landesverbandes beantragt werden. Dafür ist zum Zeitpunkt der Antragstellung ein gültiger Aufenthaltstitel bzw. ein „blauer“ Flüchtlingspass, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung erforderlich. Da eine Verlängerung dieser Dokumente der Regelfall ist, spielt ihre Gültigkeitsdauer für die Passstelle des Verbandes keine Rolle und kann kein Grund für die Ablehnung einer Spielberechtigung sein.
Kinder bis zum vollendeten 9. Lebensjahr müssen neben dem Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung nur die Kopie eines Personaldokumentes (z. B. Aufenthaltsgestattung oder Duldung) einreichen.
Bei Kindern ab dem 10. Lebensjahr und Erwachsenen wird laut FIFA-Vorgaben zusätzlich ein „internationaler Freigabeschein“ benötigt, um sicherzustellen, dass weltweit nur eine Spielberechtigung existiert. Der Freigabeschein wird mit dem Antrag auf Spielberechtigung über den Landesverband beantragt und vom Verband des jeweiligen Herkunftslandes ausgestellt. Folgende Dokumente (Vorlagen finden sich beim jeweiligen Landesverband) müssen dabei vom Verein zur Identifizierung und Prüfung eingereicht werden:- Antrag auf Spielberechtigung
- Zusatzformular für erforderliche Angaben von Spielern aus dem Ausland (zumeist auf der Rückseite des Antrags)
- Kopie eines Personaldokumentes
- Meldebescheinigung
- Zusatzformular der Eltern bzw. des Vormundes, dass sie nicht aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind
Nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der Passstelle beantragt der Landesverband über DFB und FIFA den internationalen Freigabeschein. Dabei werden persönliche Daten an den Fußballverband des Herkunftslandes übermittelt. Dies steht im Gegensatz zum Vorgehen der Behörden im Asylverfahren, die grundsätzlich keinerlei Kontakt zum Herkunftsland aufnehmen dürfen. Da Kontakte in die Heimat mitunter auch für die dort noch lebenden Freunde und Angehörigen Probleme mit sich bringen können, sollte unbedingt vor der Beantragung des Spielerpasses mit den betroffenen Geflüchteten bzw. ihren Eltern oder ihrem Vormund ein Gespräch geführt werden. Haben die Geflüchteten keine Bedenken, das FIFA-Verfahren zu durchlaufen, sind sie, wenn nach 30 Tagen keine Rückmeldung auf die Anfrage beim Nationalverband erfolgt ist, unter Vorbehalt spielberechtigt (mit Ausnahme von Wechseln in die vier höchsten Spielklassen). Bei Bedenken oder Rückfragen wird empfohlen, den jeweiligen Landesverband zur Klärung des konkreten Einzelfalls zu kontaktieren.
Gilt für minderjährige Geflüchtete das internationale Transferverbot der FIFA?
Mit Blick auf das Kindeswohl verbietet das FIFA-Reglement, mit einigen Ausnahmen, grundsätzlich den internationalen Vereinswechsel von Minderjährigen. Die FIFA hat dem DFB eine beschränkte Befreiung für den internationalen Vereinswechsel/die Erstregistrierung von Minderjährigen eingeräumt. Diese findet allerdings nur in den Fällen Anwendung, in denen die Spielerin oder der Spieler sich einem Verein unterhalb der Regionalliga anschließt. Die Einzelfallprüfung nach Vorlage diverser zusätzlicher Dokumente entfällt. Nichtsdestotrotz ist über den DFB der internationale Freigabeschein bei dem zuständigen Nationalverband unter Fristsetzung von 30 Tagen einzuholen. Beantragt ein Verein der ersten vier Spielklassen eine Spielberechtigung für eine Minderjährige oder einen Minderjährigen, wird von der FIFA geprüft, ob alle Voraussetzungen für die Ausnahmegenehmigung vorliegen.
Dürfen Geflüchtete zum Auswärtsspiel mitfahren?
Auch Spielerinnen und Spieler mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung können mittlerweile problemlos an Auswärtsspielen ihrer Mannschaft über die Bezirks- bzw. Landesgrenzen hinaus teilnehmen. Die sogenannte „Residenzpflicht“ („räumliche Beschränkung des Aufenthalts“) ist seit Ende 2014 weitgehend abgeschafft worden und gilt nun nur noch in den ersten drei Monaten des Aufenthalts im Bundesgebiet. Asylbewerberinnen und Asylbewerber dürfen in dieser Zeit den Bezirk der Ausländerbehörde, Geduldete das Bundesland nicht verlassen. Danach ist behördlicherseits nur noch der Wohnort vorgeschrieben („Wohnsitzauflage“), der aber ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde vorübergehend verlassen werden kann. Es kann jedoch weiterhin Ausnahmen und Auflagen durch die Ausländerbehörde geben. Wer der Residenzpflicht unterliegt, muss für Auswärtsfahrten bei der zuständigen Ausländerbehörde eine „Verlassenserlaubnis“ beantragen.
Dürfen Reisen ins Ausland unternommen werden?
Bei Fahrten ins Ausland müssen die individuellen Visumsbestimmungen im Zielland berücksichtigt werden, die von den Regelungen für deutsche Staatsangehörige abweichen können. Auch dürfen befristete Aufenthaltstitel nicht während der Reise ablaufen, da Probleme bei der Wiedereinreise ins Bundesgebiet entstehen können. Geduldete müssen in jedem Fall vor einer Auslandsreise rechtzeitig Kontakt mit der Ausländerbehörde aufnehmen, da eine Duldung mit der Ausreise aus Deutschland erlischt. Von der Ausländerbehörde kann in diesem Fall z. B. eine Aufenthaltserlaubnis mit kurzer Gültigkeitsdauer ausgestellt werden. Auch Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung besitzen, sollten sich vor einer Auslandsreise von der zuständigen Ausländerbehörde beraten lassen.
Geflüchtete bringen für ein Engagement im Verein oft vielfältige Erfahrungen mit. Werden Sprachbarrieren überwunden, eröffnen sich neue Chancen für alle.
Können Geflüchtete im Verein ehrenamtlich mitarbeiten?
Eine unbezahlte Mitarbeit in Vereinen oder Verbänden ist Geflüchteten in jedem Fall auch ohne die ausdrückliche Genehmigung der Ausländerbehörde erlaubt. Für ehrenamtlich Tätige besteht über die sog. „Sportversicherung“ des Vereins eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist für Nicht-Mitglieder allerdings zumeist eine vertragliche Vereinbarung notwendig. Für Geflüchtete, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, besteht die Möglichkeit, bei staatlichen oder gemeinnützigen Trägern (z. B. im Sportverein) „gemeinnützige, zusätzliche Arbeiten“ zu verrichten. Im Umfang von max. 100 Stunden pro Monat dürfen Arbeiten übernommen werden, die ansonsten gar nicht, nicht im gleichen Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würden. Die Voraussetzungen sind vorab von der Sozialbehörde zu prüfen. Die Aufwandentschädigung in Höhe von 1,05€ je Stunde wird vom Träger direkt ausgezahlt.
Können Geflüchtete Aufwandsentschädigungen erhalten?
Ja, allerdings muss für Tätigkeiten, die über eine einfache Vereinsmitgliedschaft hinausgehen, z. B. im Rahmen eines vergüteten Übungsleitervertrages, zumeist eine „Beschäftigungserlaubnis“ bei der Ausländerbehörde beantragt werden (s. u.). Auch werden in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts gezahlte Aufwandsentschädigungen vom Sozialamt auf die gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angerechnet. Danach werden Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bis zu 200 € im Monat nicht angerechnet. Eine anderweitige Entschädigung, z. B. durch Geschenke oder Gutscheine, ist dagegen immer möglich.
Wann dürfen Geflüchtete regulär beschäftigt werden?
Ausländer mit humanitären Aufenthaltstiteln (z. B. Asylberechtigte oder international Schutzberechtigte) dürfen zustimmungsfrei beschäftigt werden. Asylbewerber und Geduldete hingegen unterliegen nach ihrer Ankunft in Deutschland in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts grundsätzlich einem Arbeitsverbot. Danach haben sie zunächst einen eingeschränkten Arbeitsmarktzugang, d.h., bei einem konkreten Arbeitsplatzangebot muss stets geprüft werden, ob ein bevorrechtigter Mitbewerber ohne Beschäftigungseinschränkungen die Stelle einnehmen kann („Vorrangprüfung“) und ob die Arbeitsbedingungen gleichwertig sind. Die Vorrangprüfung entfällt nach 15 Monaten Aufenthalt. Eine Beschäftigungserlaubnis durch die Ausländerbehörde muss jedoch in jedem Fall vorliegen. Der Eintrag „Erwerbstätigkeit gestattet“ im Aufenthaltstitel bedeutet, dass auch selbstständige Arbeiten ohne behördliche Zustimmung aufgenommen werden können. Polizeiliche Führungszeugnisse oder Gesundheitszeugnisse können regulär bei der Meldebehörde bzw. beim Gesundheitsamt beantragt werden.
Können Geflüchtete ein Praktikum oder ein FSJ absolvieren?
Ein Praktikum im Rahmen einer Schul- oder Berufsausbildung oder eines EU-geförderten Programmes (z. B. ESF) bzw. eine Beschäftigung im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr ist möglich: mit Aufenthaltsgestattung nach drei Monaten Aufenthalt, mit Duldung ohne Wartefrist. Allerdings ist eine Erlaubnis durch die Ausländerbehörde notwendig.
Kommunen, Ministerien, Stiftungen und Sportverbände haben Projekte initiiert, um Vereine bei ihrer Arbeit mit Geflüchteten zu unterstützen. Auch die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Bundesliga-Stiftung engagieren sich gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten der Unterstützung.
Lokal vernetzen lohnt sich!
Um Kleiderspenden zu organisieren, Transport- oder Übersetzungsprobleme zu lösen oder Ehrenamtliche für die Vereinsarbeit zu gewinnen, kann eine gute lokale Vernetzung den Unterschied ausmachen. Die wichtigsten Ansprechpartner für die Belange von Geflüchteten sind die Kommune, insbesondere die Ausländerbehörde und das Sozialamt, sowie die Unterkünfte. Die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Institutionen und Akteuren, wie lokalen Geflüchteteninitiativen, Fördervereinen, Beratungsstellen, sozialpädagogischen Einrichtungen oder Verbänden, verspricht einen Gewinn an Kontakten, Ressourcen und Know-how. Vielerorts existieren lokale Willkommensbündnisse, in denen sich Anwohnerinnen und Anwohner und Geflüchtete gemeinsam für ein Miteinander auf Augenhöhe engagieren.
Können Kinder von Geflüchteten Zuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen?
Zuschüsse für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, um beispielsweise Mitgliedsbeiträge eines Sportvereins zu bezahlen, werden auch bei Asylbewerberinnen und Asylbewerbern oder Geduldeten berücksichtigt. Sie haben also nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Für Minderjährige, die Grundleistungen erhalten, besteht zusätzlich die Möglichkeit, „besondere Bedürfnisse“ geltend zu machen. Anträge müssen gesondert an das Sozialamt gestellt werden. Die Zuschüsse werden durch Gutscheine oder Direktzahlung (z. B. an den Verein) erbracht und können auch für mehrere Monate gebündelt werden. Antragshilfen sind u. a. bei den Flüchtlingsräten erhältlich. Über die Bedarfe für den Schulsport können beim Sozialamt auch Zuschüsse für Sportbekleidung beantragt werden.
Wie können Vereine traumatisierten Geflüchteten weiterhelfen?
Durch Verfolgung, Krieg und Flucht tragen viele Menschen körperliche und psychische Verletzungen davon. Seelische Wunden sind zumeist weniger sichtbar und auch vielen Betroffenen oft nicht bewusst. So leiden viele Geflüchtete, insbesondere auch Kinder, unter den Folgen traumatischer Erfahrungen, die durch die anhaltende existenzielle Unsicherheit im Aufnahmeland noch verstärkt werden können. Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) gilt als häufigste Folge solcher Erfahrungen und zeigt sich in unterschiedlichen körperlichen, psychischen und sozialen Symptomen. So haben traumatisierte Geflüchtete oft Schwierigkeiten, sich neu zu orientieren und ihren Alltag aktiv zu bewältigen. Die eigene Wahrnehmung, Selbstsicherheit und das Vertrauen in andere ist erschüttert. Auch nach Hilfe zu fragen, fällt dann oft nicht leicht. Im Umgang mit traumabelasteten Menschen benötigen Trainerinnen und Trainer, Mitspielerinnen und Mitspieler Sensibilität und Einfühlungsvermögen, aber auch eine gute Einschätzung ihrer persönlichen Grenzen. Sie können eine professionelle Hilfe nicht ersetzen, jedoch aktiv weiterhelfen und vermitteln: Vielerorts existieren spezialisierte psychologische Beratungsstellen. Wie stark Menschen im Alltag durch Traumata einschränkt sind, hängt auch von den gegenwärtigen Lebensumständen ab. Grundsätzlich können körperliche Aktivität und die sozialen Bindungen durch den Vereinssport zu einer Bewältigung beitragen.
Julius Hirsch Preis
Für immer einer von uns. Und für immer unvergessen.
Als Stürmer des Karlsruher FV spielte sich Julius Hirsch zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit starken Leistungen in den Fokus des Deutschen Fußball-Bundes. Die Belohnung: 1911 wurde der schussstarke Offensivspieler erstmals in die Fußball-Nationalmannschaft berufen. Bis 1913 lief Hirsch insgesamt siebenmal mit dem Adler auf der Brust auf und machte sich in dieser Zeit insbesondere wegen seines sensationellen Viererpacks gegen die Niederlande einen Namen.
Nach vielen weiteren Jahren als Spieler und Trainer wurde "Juller", der Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie, 1943 von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und ermordet. Mehr als 80 Jahre nach seinem Tod ist Hirschs Andenken aber lebendiger denn je. Denn der ehemalige Nationalspieler ist Namensgeber des Julius Hirsch Preises, mit dem Personen, Initiativen und Vereine ausgezeichnet werden, die sich gegen Antisemitismus, Diskriminierung und Rassismus einsetzen.
Leadership-Programm im Ehrenamt
Der DFB hat zum Ziel im Fußball die Vielfalt der Gesellschaft, in der er stattfindet, abzubilden. Die Diskussion um Vielfalt greift neben der Chancengleichheit vor allem den Mehrwert auf, den Organisationen durch heterogen besetzte (Führungs-)Teams haben können. Die Potentiale von Vielfalt werden beispielsweise in der Charta der Vielfalt beschrieben, zu der sich seit 2006 mehr als 2000 Unternehmen und Organisationen, auch der DFB, bekannt haben.
Sportverbände und -vereine leben von der Kompetenz und Motivation ihrer ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und Führungskräfte. Der Erfolg zeigt sich sowohl sportlich als auch in der Verbands- und Vereinsentwicklung, wie der Gewinnung neuer Mitglieder oder ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen. Führungskräften werden in diesem Kontext eine besondere Verantwortung und Herausforderung zuteil. Führung im Ehrenamt bedeutet häufig großen Gestaltungs- und Handlungsspielraum, sowie geringe Sanktions- und Anreizmöglichkeiten.
Dabei brauchen Führungskräfte Unterstützung und Orientierung, um ihren Aufgaben und Rollen zielführend nachkommen zu können. Daher kommt der Entwicklung von Führungskräften in Verbänden und Vereinen eine große Bedeutung zu

Diversität im Verband
Der DFB hat sich die Erhöhung von Diversität auf allen Ebenen im Fußball zum Ziel gemacht. Dazu gehört eine vielfältige, und somit zukunftsfähigere, Zusammensetzung von Gremien und Führungspositionen von der Spitze bis zur Basis. Dabei sollen alle Aspekte von Diversität Berücksichtigung finden: unterschiedliche Geschlechter, Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, jung/alt, verschiedene Religionen, sexuelle Orientierungen, behinderte Menschen, etc.
Das DFB-Leadership Programm für Frauen war 2016 die erste zielgruppenorientiere Maßnahme, um Diversität in den Verbandsstrukturen aktiv zu erhöhen. Nach dem bundesweiten Pilotprojekt und positiven Rückmeldungen aus den Landesverbänden, wurde die Maßnahme in den Masterplan aufgenommen, um den Landesverbänden Gelegenheit, sowie inhaltliche und finanzielle Unterstützung, zu geben, eigene Programme durchzuführen. Davon wurde und wird vielfach Gebrauch gemacht. In einigen Landesverbänden findet bereits der dritte Durchgang statt (Stand 2024).
Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte sind nach Frauen die zweitgrößte Gruppe an unterrepräsentierten gesellschaftlichen Gruppen im Fußballehrenamt. 2019 verabschiedeten DFB und die Landesverbände das in Zusammenarbeit mit Vereinen und Expert*innen erarbeitete neue Integrationskonzept: Fußball für alle - Gemeinsam für Teilhabe, Zugehörigkeit und Vielfalt in der Migrationsgesellschaft. Leadership Programme für Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte sind als eine zentrale Maßnahme im abgeleiteten Aktionsplan. Analog zum Leadership Programm für Frauen wurde eine Pilotmaßnahme auf DFB-Ebene durchgeführt. Seit Herbst 2022 haben die Landesverbänden die Möglichkeit, mit Unterstützung durch Mittel aus dem DFB-Masterplan eigene Programme für Menschen aus erster, zweiter oder dritter Generation von Eingewanderten umzusetzen.
Nie wieder
Die Initiative „!Nie Wieder“ organisiert jährlich den Erinnerungstag im deutschen Fußball. Rund um den 27. Januar, also für den Tag, als während des Winters 1945 das KZ Auschwitz befreit wurde, ruft die Initiative Vereine und Fußballfans dazu auf, sich erinnerungspolitisch zu engagieren und somit ein Zeichen gegen Antisemitismus und jede Form von Diskriminierung zu setzen. In der Initiative sind verschiedene Akteur*innen verbündet, dazu zählen: Fußballvereine, Faninitiativen, Fanprojekte, Wissenschaftler*innen, Holocaustüberlebende, Verbände wie der Zentralrat der Sinti und Roma und Makkabi Deutschland.
Für jeden Erinnerungstag wird eine besondere Personengruppe in den Fokus der Kampagne gestellt. In der Vergangenheit waren dies beispielsweise homosexuelle Menschen, Sinti und Roma oder Menschen mit einer Beeinträchtigung. Das Fokusthema wird einerseits historisch mit Blick auf das NS-Regime wie auch aktuell mit Bezug auf das heutige Deutschland betrachtet.

An der Kampagnen-Auftaktveranstaltung auf dem DFB-Campus in Frankfurt 2023 nahmen neben anderen die Holocaust-Überlebenden Eva Szepesi und Helmut „Sonny“ Sonnenberg, der Präsident des Zentralrates der Juden Dr. Josef Schuster, mit Alon Meyer der Präsident von Makkabi Deutschland und Bernd Neuendorf teil. In seiner Rede am 24. Januar 2023 unterließ es der DFB-Präsident nicht, selbstkritisch auf die Haltung des Fußballs nach der Machtübernahme 1933 zurückzublicken: „Auch der Fußball hat 1933 versagt. Und auch beim DFB waren wir keine Widerstandskämpfer. Wir haben die oft auch freiwillige Gleichschaltung, auch die der Vereine, aufgearbeitet - doch geschah dies erst zu Beginn der nuller Jahre. Bis dahin wurde geleugnet und kleingeredet.“ Bernd Neuendorf sprach anschließend über die Möglichkeiten in der Gegenwart: „Der Fußball als Begegnungsort junger Menschen, denen das Kriegsende vor bald 78 Jahren unendlich weit entfernt vorkommen muss, kann einen wichtigen Beitrag leisten, damit eine würdevolle und nicht-ritualisierte Erinnerungskultur als zentraler Baustein unseres Staatswesens bestehen bleibt.“
Solidarisches Engagement: Die DFB-Stiftungen
Die DFB-Stiftung Egidius Braun, die DFB-Kulturstiftung und die DFB-Stiftung Sepp Herberger realisieren und fördern bundesweit und über Deutschlands Grenzen hinaus zahlreiche soziale, gesellschaftspolitische und kulturelle Initiativen und Projekte. Die Schwerpunkte der drei DFB-Stiftungen liegen in den Bereichen Integration & Verständigung (DFB-Stiftung Egidius Braun), Kultur & Bildung (DFB-Kulturstiftung) sowie Inklusion & Solidarität DFB-Stiftung Sepp Herberger).